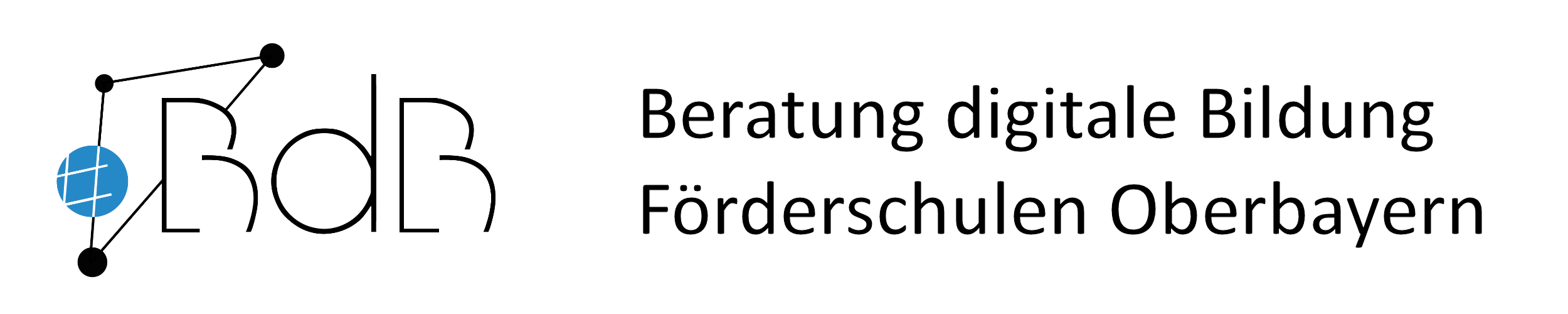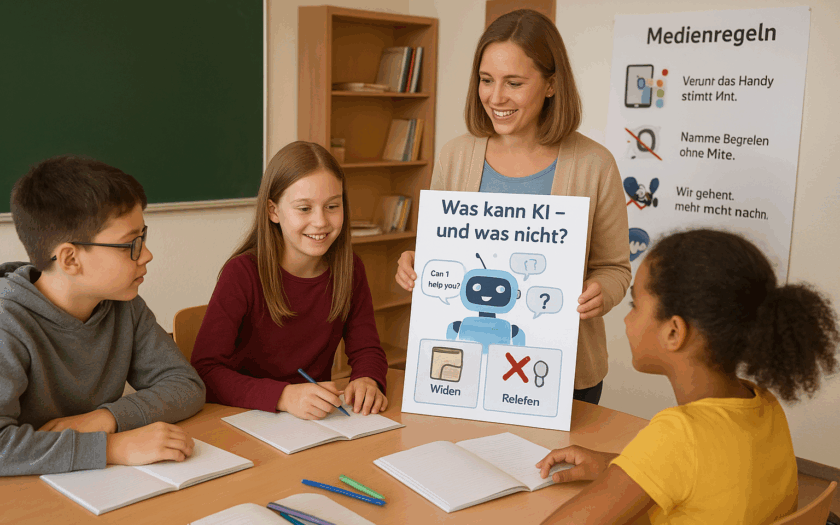Der Artikel Guter Unterricht in einer digitalen Welt, der im mebis Magazin veröffentlicht wurde, nennt als eines von fünf zentralen Kriterien für gelingendes Lernen den Begriff Lebensweltbezug. Dass dieser die Motivation von Lernenden erhöht und damit Lernen als solches erst ermöglicht, ist natürlich keine digitale Entdeckung, sondern ein seit Langem bekanntes Faktum aus der Lernpsychologie und bereits viele Jahre als ein Kennzeichen guten Unterrichts im Bayerischen Qualitätstableau festgeschrieben: Menschen knüpfen an bekannte Situationen besser an, als an unbekannte.
Der Begriff Lebensweltbezug beschreibt allgemein, dass Inhalte, Methoden oder Themen an die konkrete Lebensrealität, Erfahrungen, Interessen und Bedürfnisse von Menschen angeknüpft werden. Sprechen wir beispielsweise mit Jugendlichen über den Russlandfeldzug Napoleons, wird die Reaktion vermutlich eine andere sein, als wenn wir über unsere „Stats“ in der neue Fortnite-Season sprechen und seltene Skins präsentieren. Erfahrungen von Lehrkräften, die mit aktuellen Formaten wie z. B. Videoerstellung, Memes oder Podcast arbeiten, bestätigen, dass Schülerinnen und Schüler an Förderzentren mit hoher Motivation an solche Projekte herangehen und Erfahrungen aus ihrer Lebenswelt produktiv einsetzen.

Ein im Unterricht erstelltes Meme zum Thema Hausordnung
Mit Blick auf die sich zunehmend digital entwickelnde Alltagswelt liefert die JIM-Studie einen realistischen Einblick in die Lebenswelt von Jugendlichen. Sie bietet aktuelle (2024) Daten zu Zugängen und Nutzungsweisen digitaler Endgeräte. Auch wenn die Studie keine spezifischen Angaben zu Jugendlichen aus den verschiedenen Förderschulbereichen macht, lässt sich aus der täglichen Erfahrung mit unseren Schülerinnen und Schülern ableiten, dass die dort beschriebenen Grundtendenzen auch für diese zutreffen.
Ein Blick auf die Jim-Studie ergibt folgendes Bild:
- Smartphones dominieren: 96 % der Jugendlichen besitzen ein Smartphone und nutzen es täglich im Schnitt über vier Stunden. Es ist das zentrale Gerät für Kommunikation, Information und Unterhaltung.
- Soziale Medien: WhatsApp, YouTube, Instagram und TikTok sind die unangefochtenen Spitzenreiter. Insbesondere TikTok hat eine enorme Bedeutung für den schnellen, visuellen und algorithmusgesteuerten Konsum.
- Informationsverhalten: YouTube, Google und zunehmend auch TikTok werden als primäre Informationsquellen genutzt. Die klassische Nachrichtenquelle spielt eine untergeordnete Rolle.
- Digitale Risiken: Konfrontation mit Hassbotschaften, Fake News und problematischen Inhalten ist für eine Mehrheit der Jugendlichen Alltag. Cybermobbing bleibt ein relevantes Problem.
- Künstliche Intelligenz: Fast die Hälfte der Jugendlichen hat bereits Erfahrungen mit KI-Textgeneratoren wie ChatGPT gemacht, primär aus Neugier oder für die Schule.
Keine dieser Erkenntnisse überrascht. Sie bestätigen die Eindrücke, die wir als Eltern oder Lehrkräfte machen: Schülerinnen und Schüler, die vor der Schule auf ihre Handys starren, Streitigkeiten in WhatsApp-Klassengruppen, Wahrheiten aus der „Insta-Blase“ oder Fake News von TikTok. Auch erste Erfahrungen mit KI-Tools sind inzwischen Unterrichtsthema.
Welche Rückschlüsse ergeben sich daraus für uns Förderschulen?
- Die Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler anerkennen, nicht ignorieren: Eine Vermeidung von mobilen Endgräten oder die Ignoranz gegenüber Plattformen wie TikTok entfernt uns von der Realität unserer Schülerinnen und Schüler. Für viele von ihnen, insbesondere mit sozial-emotionalen oder kommunikativen Einschränkungen, ist das Smartphone das wichtigste Fenster zur sozialen Teilhabe.
- Besondere Vulnerabilität: Unsere Schülerinnen und Schüler sind aufgrund von Lernschwierigkeiten, geringerer Impulskontrolle oder sozialer Unsicherheit oft noch anfälliger für die Risiken der digitalen Welt (z.B. Fake News, Cybergrooming, Abzocke).
- Kurzformate als Chance: Die Dominanz von kurzen, visuellen Formaten (TikTok, YouTube Shorts) entspricht oft der Aufmerksamkeitsspanne und dem Verarbeitungsstil vieler unserer Schülerinnen und Schüler. Dies können wir didaktisch nutzen: Erklärvideos, visuelle Anleitungen oder einfache digitale Präsentationen können effektiver sein als lange Texte.
- Informationskompetenz als Kernaufgabe: Wenn Schülerinnen und Schüler TikTok als Suchmaschine nutzen, müssen wir ihnen beibringen, wie man Quellen bewertet. Dies muss auf einem sehr basalen Niveau geschehen: „Wer hat das Video gemacht?“, „Woran erkenne ich Werbung?“, „Wo kann ich nachfragen, ob das stimmt?“.
Das Kultusministerium und das ISB haben mit dem Artikel „Guter Unterricht in einer digitalen Welt“ unterstützende Materialien für Schulen entwickelt und veröffentlicht, mit deren Hilfe sich Digi-Teams, Schulentwicklungsteams und ganze Kollegien auf den Weg machen können, Konzepte zu entwickeln, Strukturen und Regeln einzuführen, Anwendungsmöglichkeiten von mobilen Endgeräten für einzelne Stufen zu implementieren, die dazu führen, dass wir als Lehrkräfte unsere Schüler in ihrer Welt begleiten und stärken, um sinnvoll aktiv daran teilhaben zu können. Ganz konkret geht es dabei um:
- eine über die privaten Unterhaltungs- und Kommunikationszwecke hinausgehende, produktive Mediennutzung
- die Reflexion des eigenen Medienverhaltens
- gezielte Präventionsarbeit vor übermäßigem Medienkonsum sowie problematischen Inhalten
Wir Sonderpädagoginnen und -pädagogen sind Experten, Themen und Methoden so aufzubereiten, dass alle unserer Schülerinnen und Schüler so aktiv wie möglich partizipieren können. Die digitale Welt ist für unsere Schülerschaft an Förderschulen sowohl eine große Chance als auch ein großes Risiko. Unsere Aufgabe ist es, die Risiken durch Struktur, Regeln und Aufklärung zu minimieren und die Chancen durch einen didaktisch sinnvollen, individualisierten und assistiven Einsatz von Technologie zu maximieren.
Der Einsatz digitaler Medien ermöglicht es die individuellen Interessen und Lernwege der Schülerinnen und Schüler zu berücksichtigen, so dass diese in der Auseinandersetzung mit Lebenswelt bezogenen Inhalten Kompetenzen aufbauen können, die sie zur Teilhabe an einer immer stärker digitalen ausgeprägten Gesellschaft teilhaben können. Hilfreich dabei ist die vielfältige Möglichkeit der zur Verfügung stehenden Medien, wie z. B. Zeitungsartikel, Fernsehbeiträge, Podcasts, Videokanäle, Wikis oder Webseiten.
Diese Aufgaben können Lehrkräfte alleine in ihrer Klasse nicht bewältigen. Es bedarf einer gemeinsamen Anstrengung der gesamten Schulfamilie. Ein gelebtes Medienkonzept an Schulen, klare Strukturen in der Ausstattung, fortlaufende Fortbildungen innerhalb und außerhalb des Kollegiums, gemeinsame Standards bei Apps und Arbeitsweisen helfen uns Lehrkräften dabei, Schülerinnen und Schülern Rückhalt in ihrer digital geprägten Lebenswelt zu geben.